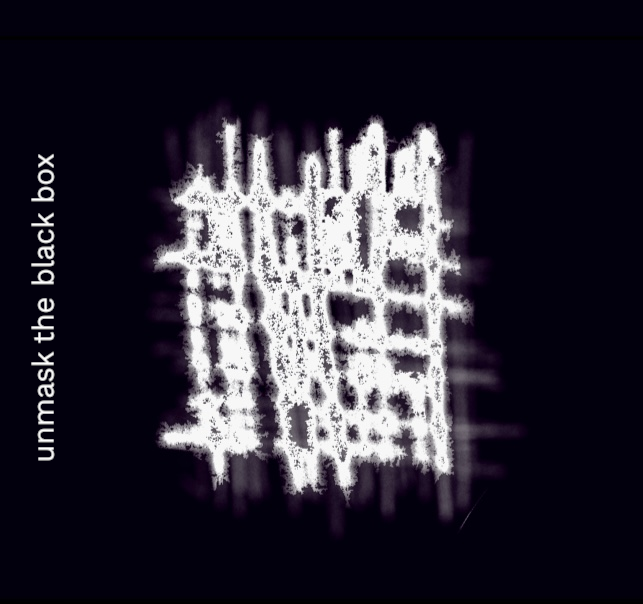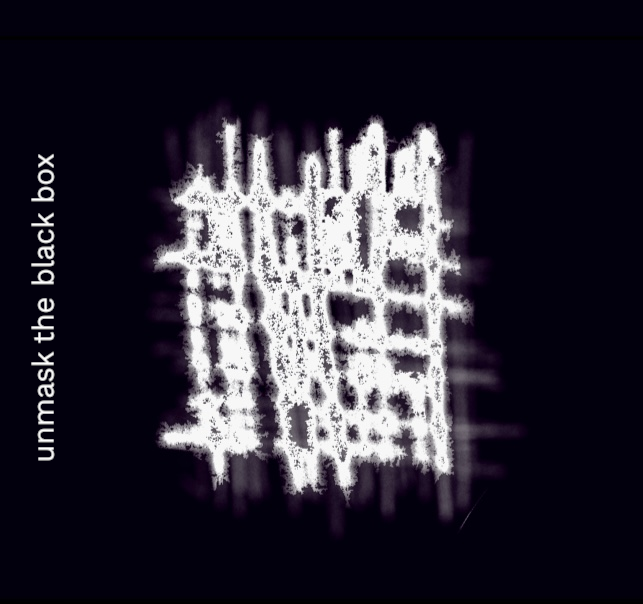
In dieser Podcast-Reihe diskutieren Forschende und Praktiker*innen, wie digitale Technologien – insbesondere Künstliche Intelligenz – die ästhetischen Schulfächer und deren Vermittlung verändern. Der Podcast verbindet wissenschaftliche Perspektiven mit konkreten Praxisfragen, um ästhetische Urteilsfähigkeit und Teilhabe im Unterricht neu zu denken. Wir – Antje Winkler und Benjamin Hecht – verstehen uns dabei als Gastgeber*innen und impulsgebende Moderator*innen.
Unmask the Black Box will postdigitalen, KI-gestützten Systemen etwas von ihrem Abstraktionsgrad nehmen. Denn oft sind nur Ein- und Ausgaben sichtbar (vgl. Ribeiro, 2016), während die Prozesse dazwischen im Verborgenen bleiben. Im Gespräch versuchen wir, diesen „Black Boxes“ Wahrheitsgehalte zu entlocken und ein besseres Verständnis für durchdigitalisierte Systeme zu ermöglichen.
Um die Relevanz einer kritischen Auseinandersetzung mit Digitalisierung im künstlerischen Klassenzimmer zu erfassen, beleuchtet der Podcast sowohl die Systemkomplexität als auch die häufig unzureichende Informationslage. Ziel ist es, Vertrauen in eine kritische und ko-kreative Wissensbildung aus der Perspektive der Künste zu stärken.
Eine BMBF-geförderte Podcastproduktion im Rahmen des Verbundprojekts DigiProSMK, CoP3 – zum kritischen Umgang mit KI, Digitalisierung und Deepfake in der (inter)disziplinären Arbeit in Kunst, Musik und Film.
Idee, Konzept und Moderation: Antje Winkler, Benjamin Hecht
Logo: Dr. Julia Schneider (alias Doc J Snyder) [ http://docjsnyder.net ]
Aufnahme und Postproduktion: Benjamin Hecht
Aufnahmeleitung: Sophie Narr
Critical Friends: Alpha-Maria Heidel, Christine Woditschka, Monika Richter, Annette Ziegenmeyer, Oliver Krämer, Andreas Brenne, Fabian Bade
*Postdigitalität: Der Begriff findet seit den 2000er Jahren mit Kim Cascone (s.u.) Einzug in die Diskurse um digitale Musik, Kunst und Philosopie und beschreibt einen gesellschaftlichen Zustand, in dem Digitalisierung (gesellschaftliche Überformung durch digitale Technologie/Internet/Endgeräte) vollzogen ist bzw. einen Normalzustand oder normativen gesellschaftlichen Charakter angenommen hat. Cascone, K. (2000). The aesthetics of failure; tendencies in contemporary computer music. Computer Music Journal, 24(4), https://doi.org/10.1162/014892600559489, 12–18
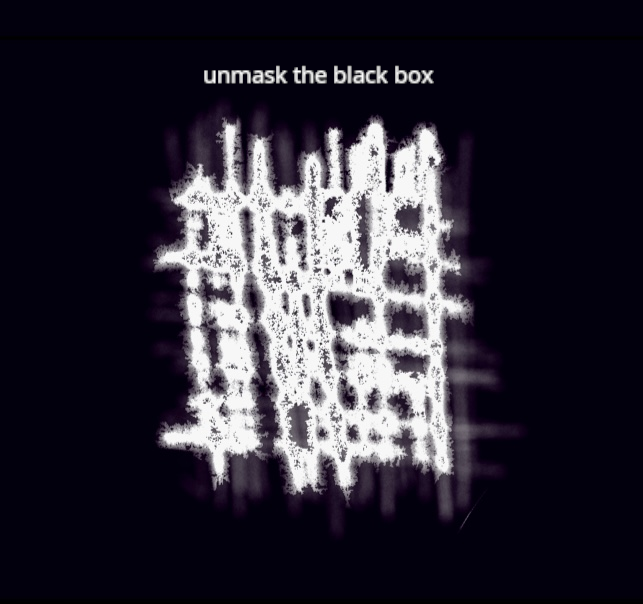
Was bedeutet Digital Literacy heute? Wie lässt sich KI sinnvoll im Unterricht behandeln? Und warum ist Prince’ Satz „Don’t be fooled by the Internet“ aktueller denn je? Antje Winkler (Kunstpädagogik, Uni Potsdam) und Benjamin Hecht (Musikpädagogik, HMT Rostock) stellen sich und das Konzept des Podcasts vor: eine kritische Auseinandersetzung mit Digitalisierung, KI und künstlerischer Bildung in der postdigitalen Gegenwart.
Ziel ist ein intermediales Erzählen und Handeln im künstlerischen Klassenzimmer – über und mit Text, Bild, Ton, Code oder Performance. Der Podcast bringt Perspektiven aus Wissenschaft, Kunst, Pädagogik und Unterrichtspraxis zusammen und versteht Erzählen als ästhetische, gesellschaftliche und bildende Praxis – mit einem konsequenten Arbeiten von der Kunst aus (Sturm 2005). Im Mittelpunkt steht eine reflektierte, diskriminierungskritische Haltung im Umgang mit digitalen Technologien – jenseits reiner Techniknutzung, hin zu kritischer Teilhabe und Gestaltung.
Shownotes
Prince [The Artist Formerly Known As Prince]. (1999). Yahoo! Internet Life Online Awards – Presentation of the „Online Pioneer“ award to Public Enemy [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=sMHaKdcPid8 (Zugriffsdatum: 31. Mai 2025)
„Digital Literacy“, „Reflektiertheit“, „Lesekompetenz“, vgl. hierzu: Jenkins, H., Clinton, K., Purushotma, R., Robison, A. J., & Weigel, M. (2009). Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century. The MIT Press. https://direct.mit.edu/books/oa-monograph/3204/Confronting-the-Challenges-of-Participatory
Sturm, Eva (2005): Vom Schießen und vom Getroffen-werden. Kunstpädagogik und Kunstvermittlung ‚Von Kunst aus‘, in: Pazzini, Karl-Josef/Sturm, Eva/Legler, Wolfgang/Meyer, Torsten (Hg.): Kunstpädagogische Positionen. Heft 7, Hamburg: University Press.
Kramer, M., Riettiens, L., Schütze, K., & Vollmert, C. (Hrsg.). (2025). Bildung des Narrativen – Transdisziplinäre Perspektiven auf intermediales Erzählen in der Postdigitalität. München: kopaed.
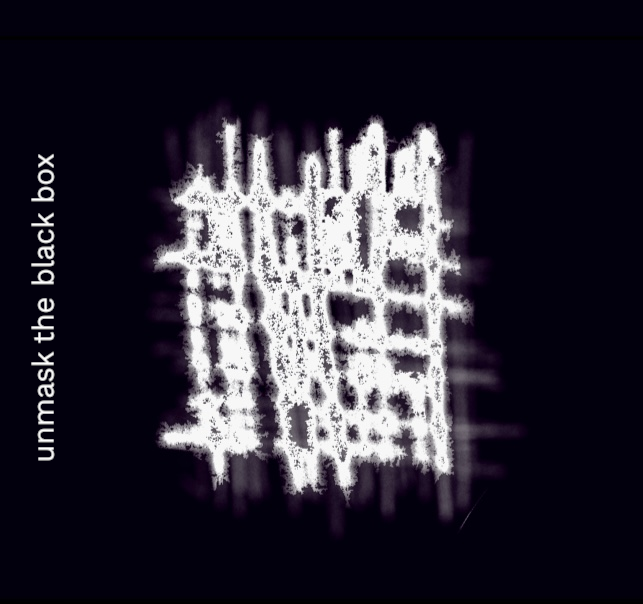
In Folge 1 wird diskutiert, welche Aufgaben Schule unter digitalen Bedingungen übernehmen sollte, wie sich der Unterricht durch KI konkret verändert und wie eine „critical digital literacy“ – auch über Kunst – gefördert werden kann. Thematisiert werden zudem das Fortbildungsangebot von Fobizz, das Technology Acceptance Model (TAM) und die Studie „KI-Korrekturhilfe“ des Chaos Computer Clubs (Muehlhoff/Henningsen, 2025).
Zu Gast: Sonja Siemens unterrichtet Latein, Philosophie und Deutsch als Fremdsprache an der Deutschen Schule London und ist Koordinatorin für Digitalen Unterricht. Im Podcast berichtet sie aus dem Schulalltag und zeigt, wie KI als persönliches Lernsetting genutzt werden kann. Sie versteht KI als Katalysator tiefgreifender Bildungsprozesse, der kulturelle Praktiken verändert und Schule herausfordert, sich neu zu positionieren.
Shownotes
Mühlhoff und Henningsen (2025) untersuchen das KI-Tool „AI Grading Assistant“ von Fobizz und kritisieren, dass KI im Unterricht keine Lösung für soziale Bildungsprobleme sei. Mühlhoff, R., & Henningsen, M. (2025). Chatbots im Schulunterricht: Wir testen das Fobizz-Tool zur automatischen Bewertung von Hausaufgaben. https://arxiv.org/abs/2412.06651(Zugriff am 31. Mai 2025)
Ein KI-Tutoring System oder ITS (Intelligentes tutorielles System) kann Lernende individuell anleiten und personalisierte Rückmeldungen geben. Fortschritte im Deep Learning machen die Personalisierung technisch einfacher. Dies kann zum Beispiel bei der Binnendifferenzierung im Unterricht hilfreich eingesetzt werden. EB Zürich. (o. D.). Einen eigenen KI-Tutor entwickeln – Zwischenbericht zum Projekt. https://www.eb-zuerich.ch/blog/einen-eigenen-ki-tutor-entwickeln-zwischenbericht-zum-projekt (Zugriffsdatum: 28. Mai 2025)
Das Technology Acceptance Model (TAM) erklärt, wie Nutzer*innen Technologie annehmen. Entscheidend sind die wahrgenommene Nützlichkeit und Benutzerfreundlichkeit, die die Nutzungsbereitschaft beeinflussen (Davis, 1989). Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008
Unter humanoiden Robotern versteht man Roboter, die wie Menschen aussehen. Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon. (o. D.). Humanoide Roboter. https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/humanoide-roboter-172731 (Zugriffsdatum: 31. Mai 2025)
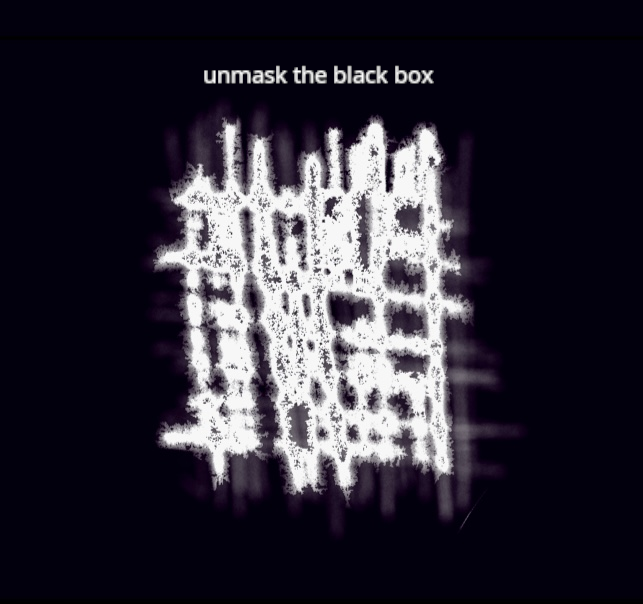 Folge 2_Wer komponiert hier eigentlich? KI, Musikpädagogik und die Zukunft des Lernens | Im Gespräch mit Tobias Rotsch
Folge 2_Wer komponiert hier eigentlich? KI, Musikpädagogik und die Zukunft des Lernens | Im Gespräch mit Tobias Rotsch Podcast-Folge 2 verhandelt KI und Kreativität aus künstlerischer Sicht: Wie kreativ ist das Komponieren mit KI-Tools? Wer ist dabei eigentlich kreativ – Mensch oder Maschine? Ist KI eher Werkzeug oder interaktiver Partner? Wie verändert Prompting musikalisches Denken, und was bedeutet das für körperliche Erfahrung beim Musizieren? Rotsch diskutiert, ob KI-generierte Musik eher rezipiert oder produziert wird, und was es braucht, um sinnvoll zu prompten. Mit einem Exkurs zu Wallbaums Prozess-Produkt-Didaktik und selbst erzeugten KI-Musikbeispielen – alles im Kontext eines erweiterten Lernraums durch XR.
Zu Gast: Tobias Rotsch ist Musikpädagoge, Songwriter und Digitalisierungsexperte an der Hochschule für Musik Trossingen. Im Projekt LEVIKO-XR erforscht er den Einsatz von Extended Reality im Musikunterricht.
Shownotes
KI-Tools sind Softwareanwendungen, die künstliche Intelligenz (KI) nutzen, um Aufgaben zu automatisieren, Muster zu erkennen oder Entscheidungen zu treffen. Es gibt verschiedene Arten von KI-Tools, zum Beispiel Machine Learning Algorithmen, Large Language Models, Bilderkennungs- und -generierungssoftwares, u.a. Team Digitale Lehre, Universität Siegen. (o. D.). KI-Tools – Wissensdatenbank Digitale Lehre. https://digitale-lehre.uni-siegen.de/wissensdatenbank/ki-tools/ (Zugriffsdatum: 31. Mai 2025)
Large Language Models (LLMs), übersetzt Große Sprachmodelle sind KI-Modelle, die menschliche Sprache verstehen und generieren können, zum Beispiel GPT-4 von OpenAI oder Llama 2 von Meta. Kelbert, P., et al. (2023). Was sind Large Language Models? Und was ist bei der Nutzung von KI-Sprachmodellen zu beachten? Fraunhofer IESE – Blog des Fraunhofer-Instituts für Experimentelles Software Engineering. https://www.iese.fraunhofer.de/blog/large-language-models-ki-sprachmodelle/ (Zugriffsdatum: 27. Januar 2025)
Die Prozess-Produkt-Didaktik wurde von Christopher Wallbaum als Modell für den Musikunterricht weitergedacht, bei dem die Schüler*innen von einer Lehrkraft unterstützt, verschiedene Musikpraxen komponieren. Wallbaum, C. (2018). Unterrichtsgestaltung als Komponieren: Das musikdidaktische Modell Musikpraxen erfahren und vergleichen und Neue Musik. In Handreichungen zur Kompositionspädagogik (S. 1–8). https://www.kompaed.de/fileadmin/files/Artikel/KOMPAED-Wallbaum_13.6.18.pdf (Zugriffsdatum: 27. Januar 2025), hier: S. 4.
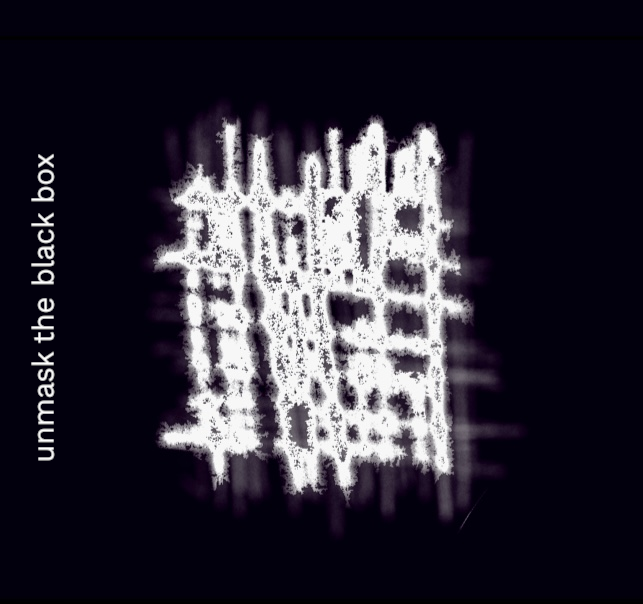 Folge 3_Wir wollen wissen, was in dem Gerät passiert! Eine feministische Dekonstruktion der KI und Kontrolle. Im Gespräch mit Beata Hubrig und Katharina Mosene
Folge 3_Wir wollen wissen, was in dem Gerät passiert! Eine feministische Dekonstruktion der KI und Kontrolle. Im Gespräch mit Beata Hubrig und Katharina MoseneIn dieser Folge sprechen die Juristin für Datenschutz und Urheberrecht Beata Hubrig und die Politikwissenschaftlerin mit intersektional feministischen Ansätze im Kontext von Internet Governance Katharina Mosene über Macht, Teilhabe und Verantwortung in der datenbasierten Gesellschaft. Aus intersektional-feministischer Perspektive beleuchten sie die oft unsichtbaren Mechanismen hinter KI-Systemen, algorithmischer Diskriminierung und digitaler Überwachung. Gemeinsam fragen sie: Wer schreibt die Regeln der digitalen Welt – und für wen? Themen wie Data Feminism, erklärbare KI, Predictive Policing und Deepfakes werden mit künstlerischen Positionen von Hito Steyerl, Harun Farocki und Forensic Architecture verwoben.
Zu Gast: Beate Hubrig (Juristin) und Katharina Mosene (Politikwissenschaftlerin)
Shownotes
Intersektionaler Feminismus beleuchtet Mehrfachdiskriminierung, etwa von Schwarzen Frauen, die zugleich Rassismus und Sexismus erfahren. Der Ansatz entstand aus Schwarzen feministischen Bewegungen in den USA (Kelly, 2021). Kelly, N. (2021, 25. März). Intersektionalität als Zukunftsperspektive. Diversity Kolumne #3. Deutsche Filmakademie. https://www.deutsche-filmakademie.de/meldungen/diversity-kolumne-3/ (Zugriff am 31. Mai 2025)
Predective Policing = Vorhersagebasierte Polizeiarbeit … Lum, K., & Isaac, W. (2016). To predict and serve? Significance, 13(5), 14–19. https://doi.org/10.1111/j.1740-9713.2016.00960.x (Lizenziert unter CC BY-NC-ND 3.0 DE); Egbert, S. (2017, 4. August). Siegeszug der Algorithmen? Predictive Policing im deutschsprachigen Raum. Gesellschaft – Technik – Überwachung. https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/253603/siegeszug-der-algorithmen-predictive-policing-im-deutschsprachigen-raum/ (Zugriffsdatum: 31. Mai 2025)
Intelligente Überwachungskameras liefern hochauflösende Livebilder und übertragen Daten via Internet an vernetzte Geräte. Sie können mit smarten Systemen wie Türschlössern verbunden sein. Speicherorte (z. B. Cloud, NAS) und Übertragungswege variieren je nach Modell. Schwachstellen entstehen häufig durch unsichere Nutzung, etwa durch schwache Passwörter (BSI, o. D.). Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). (o. D.). Smarte Überwachungskameras – Worauf Sie achten sollten. https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Internet-der-Dinge-Smart-leben/Smart-Home/Smarte-Ueberwachungskameras/smarte-ueberwachungskameras.html (Zugriff am 31. Mai 2025)
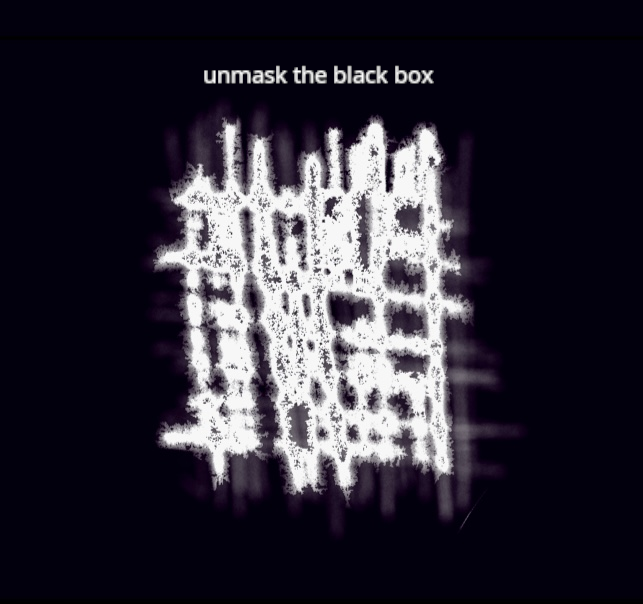
Podcast-Folge 4 diskutiert, ob KI im Filmschaffen disruptiv oder unterstützend wirkt und ob sie kreativ überraschen kann. Weitere Themen sind Deepfakes, „Fake-Porn“, sexualisierte Gewalt über digitale Medien, algorithmische Diskriminierung sowie die Bedeutung von Medienkompetenz, Vertrauen und Verantwortung im digitalen Zeitalter. Zudem geht es um Tech-Versprechen – und wie sie zu neuen Anforderungen und Anrufungen werden.
Zu Gast: Ute Kalender, Dr., ist Kultur- und Genderwissenschaftlerin. Sie forscht zur Intersektionalität von Gender, Technologie und KI. Ihre Seminare thematisieren digitale Gegenwarten aus Sicht postmarxistischer, postkolonialer, Glitch- und Queer-Feminismen – jenseits kanonisierter Stimmen. https://utekalender.de/
Tobias Frühmorgen ist Filmemacher, Dozent an der Lusófona Universität Lissabon und Mitglied im Select-Komitee für Green Production. An der Filmuniversität Babelsberg promoviert er zu KI und Scriptwriting – mit künstlerischem Fokus: Kann KI kreativ sein? https://tobiasfruehmorgen.de/
Shownotes
Meyer-Drawe, K., & Ganss, S. (2023). Künstliche Intelligenz (KI) und die Frage nach dem Menschen: Ein Gespräch zwischen Käte Meyer-Drawe und Sarah Ganss. Zeitschrift für Pädagogik und Theologie, 75(2), 128-138.
Meyer-Drawe, K. (2022). Im Verborgenen lernen: Künstliche Intelligenz. In T. Becker, F. Jilek, & S. Macgilchrist (Hrsg.), Digitalisierung und Bildung. Materialien zu einem problematischen Verhältnis (S. 41-51). schulheft, 188. https://schulheft.at/hefte/hefte-185-196/heft-188
Misselhorn, C. (2021). Künstliche Intelligenz und Empathie: Vom Leben mit Emotionserkennung, Sexrobotern & Co. Stuttgart.
Turing, A. (2021 [1950]). Computing Machinery and Intelligence. Können Maschinen denken? (A. Stephan & S. Walter, Hrsg. & Übers.). Stuttgart.
Weise, J. (2019). Cyborg Detective. BOA Editions.
Weise, J. (2018, September 24). Common Cyborg. Granta. https://granta.com/common-cyborg/
Wiener, N. (1972). Mensch und Menschmaschine: Kybernetik und Gesellschaft. Frankfurt am Main.
Jillian Weise, bekannt als The Cyborg Jillian Weise, ist eine US-amerikanische Dichterin, Romanautorin, Performancekünstlerin und Aktivistin für Behindertenrechte. Geboren 1981 in Houston, Texas, lebt und arbeitet sie heute als Associate Professorin für Creative Writing an der Florida State University. Weise, J. (o. D.). About. Jillian Weise. https://jillianweise.com/about; Florida State University. (o. D.). Jillian Weise – Associate Professor. https://english.fsu.edu/faculty/jillian-weise
Green Production bezeichnet die umweltfreundliche Gestaltung von Produktionsprozessen, bei der Ressourcen geschont, Emissionen reduziert und nachhaltige Materialien verwendet werden, um ökologische Auswirkungen zu minimieren. Abdellatif, M. M. A. (2024). Green production and sustainable manufacturing: A comprehensive review. Premier Journal of Engineering, 1, 100002. https://doi.org/10.70389/PJE.100002
Sexualisierte Gewalt bezeichnet jede sexuelle Handlung, die gegen den Willen einer Person erfolgt, unter Zwang, Drohung oder Ausnutzung von Machtverhältnissen – unabhängig von körperlichem Kontakt. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2023). Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche: Forschungsstand und Perspektiven. BMBF. https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/DE/3/31125_Sexualisierte_Gewalt_gegen_Kinder_und_Jugendliche.pdf
„Fake-Porn“ (auch „Deepfake-Pornografie“) bezeichnet pornografische Inhalte, in denen Gesichter oder Körper von Personen – meist ohne deren Zustimmung – digital in explizite Szenen montiert werden, meist mittels KI-gestützter Deepfake-Technologie. Chesney, R., & Citron, D. K. (2019). Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security. California Law Review, 107(6), 1753-1819. https://doi.org/10.2139/ssrn.3213954
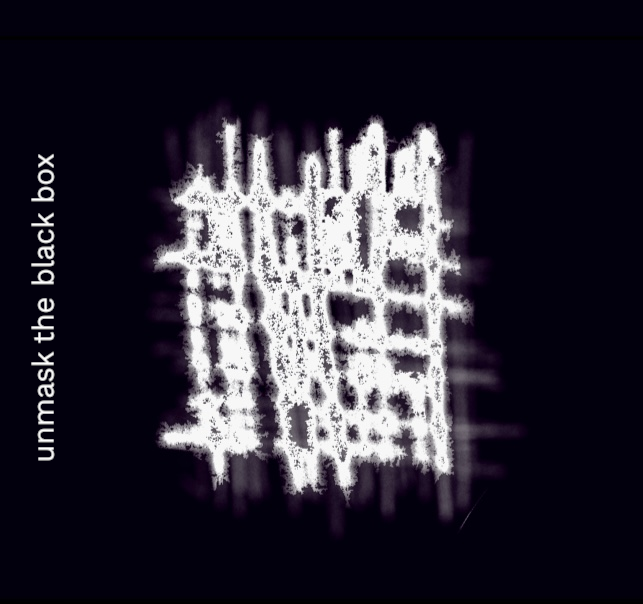
In der fünften Folge sprechen Antje Winkler und Benjamin Hecht mit der Ökonomin und Comic-Autorin Dr. Julia Schneider (alias Doc J Snyder) sowie dem künstlerisch Forschenden Niklas Washausen über das Zusammenspiel von Kunst, Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft.
Ausgehend von Julias Comic We Need to Talk, AI geht es um feministische Perspektiven auf künstliche Intelligenz, Big Data, Postdigitalität, Technologie als Gesprächskörper, affektive Dimensionen von KI und die Kommerzialisierung des Digitalen. Diskutiert werden außerdem Themen wie Glitch-Art, Spamkultur, Mensch-Maschine-Verhältnisse, Deepfakes, digitale Körperbilder sowie der Einfluss von Popkultur und Plattformen wie OnlyFans oder Instagram auf unser Technikverständnis. Ein vielschichtiges Gespräch über Kultur, KI und Kapitalismus.
Zu Gast: Ökonomin und Comic-Autorin Dr. Julia Schneider (alias Doc J Snyder) und Niklas Washausen (Kunstpädagoge und Künstler)
Shownotes
*„We Need to Talk, AI“ ist ein 2019 veröffentlichter Comic-Essay von Dr. Julia Schneider (alias Doc J Snyder) und der Künstlerin Lena Kadriye Ziyal. Das Werk bietet einen niedrigschwelligen, visuell ansprechenden Einstieg in die komplexe Welt der Künstlichen Intelligenz (KI) und beleuchtet sowohl technische Grundlagen als auch gesellschaftliche, ethische und politische Fragestellungen. Schneider, J., & Ziyal, L. K. (2019). We need to talk, AI: A comic essay on artificial intelligence. https://weneedtotalk.ai/
Artistic Research (künstlerische Forschung) ist ein Forschungsansatz, bei dem künstlerische Praxis selbst als Erkenntnismethode dient. Die Forschung wird durch, in und mit der Kunst betrieben und reflektiert – oft jenseits traditioneller wissenschaftlicher Verfahren. Borgdorff, H. (2012). The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia. Leiden University Press.
Glitch-Art ist eine künstlerische Praxis, die digitale Fehler (Glitches) – wie Bildstörungen, Datenkorruption oder Systemabstürze – gezielt ästhetisch einsetzt. Sie nutzt technische Störungen als Stilmittel, um visuelle, klangliche oder konzeptuelle Irritationen zu erzeugen. Menkman, R. (2011). The Glitch Moment(um). Institute of Network Cultures, https://networkcultures.org/blog/publication/no-04-the-glitch-momentum-rosa-menkman/
Cyborgs (Kurzform für cybernetic organisms) sind Mischwesen aus Organismus und Maschine. Sie kombinieren biologische und technische Komponenten – etwa Prothesen, Implantate oder Sensoren –, um menschliche Fähigkeiten zu erweitern oder zu ersetzen. Haraway, D. J. (1991). A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century. In Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature (S. 149-181). Routledge.
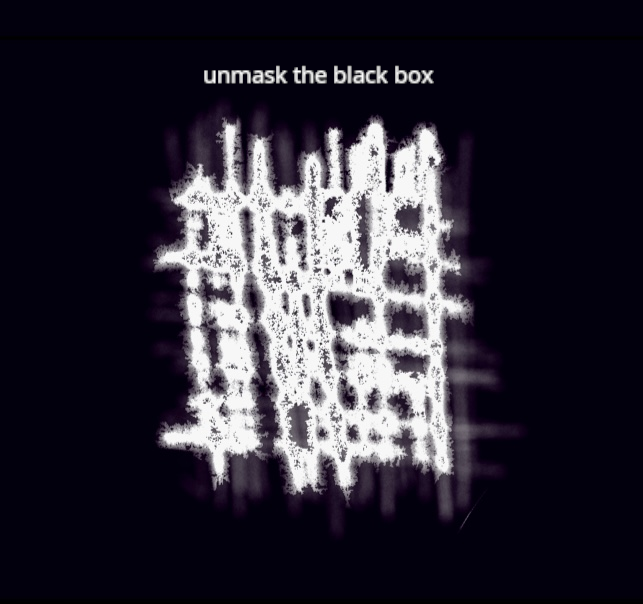
In Folge 6 von Unmask the Black Box geht es um Wahrnehmung als Mustererkennung, um Mensch-Maschine-Relationen und um eine Bildungslandschaft, die echte intellektuelle Entwicklung ermöglicht – für alle.
Zu Gast ist der Kognitionswissenschaftler Joscha Bach, der Künstliche Intelligenz als Spiegel für menschliches Denken nutzt. Aufgewachsen in einer Künstler*innenfamilie und Gründer eines Instituts für Maschinenbewusstsein in San Francisco, diskutiert er mit den Hosts über KI, Geist und Lernen. Sprache wird als musikalisches Phänomen betrachtet – und die großen Fragen gestellt: Ist KI bloß eine Collage aus Daten oder eine kreative Partnerin? Wie verändert sie Bildung, Lernen und unsere Vorstellung von Prüfungen? Kann sie Dialogpartnerin, Tutorin oder sogar Freundin sein?
Shownotes
Hito Steyerl ist Filmemacherin, Künstlerin und Autorin. In ihrem Werk beschäftigt sie sich mit postkolonialen und feministischen Fragestellungen und bewegt sich dabei zwischen Kunst, Film und theoretischer Reflexion. Steyerl, H. (o. D.). Prof. Dr. phil. Hito Steyerl. Universität der Künste Berlin. https://www.udk-berlin.de/person/hito-steyerl/ (Zugriffsdatum: 30. Mai 2025)
Propriozeption bezeichnet die Fähigkeit, den eigenen Körper und seine Bewegungen im Raum wahrzunehmen, wobei diese Informationen aus dem inneren Bewegungssystem stammen und häufig ergänzend zu anderen Sinneseindrücken genutzt werden, Stephan, A., & Walter, S. (2013). Handbuch Kognitionswissenschaft. In J. B. Metzler (Hrsg.), J.B. Metzler eBooks. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05288-9, hier S. 86.
Utopistische, Utopie kann als hoffnungsgeleitetes Denken verstanden werden, das über bestehende gesellschaftliche Zustände hinausgeht und auf potenzielle, noch nicht realisierte Möglichkeiten abzielt. Bloch, E. (1959). Das Prinzip Hoffnung (3 Bände). Suhrkamp.
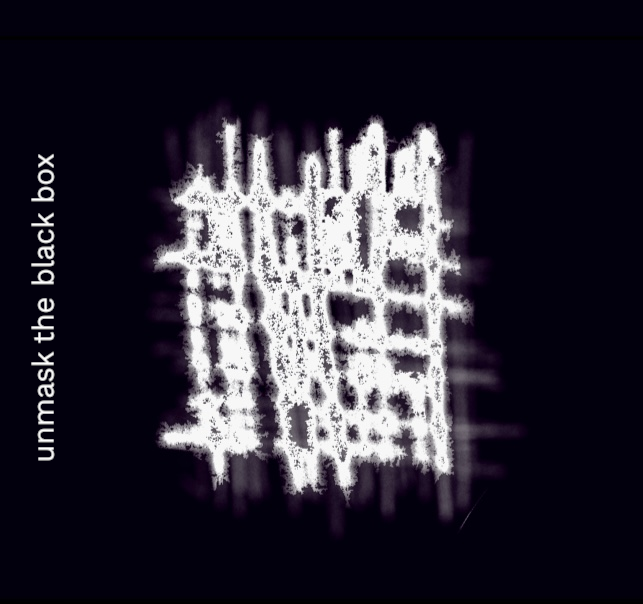
Im Fokus der Podcast-Folge 7 stehen aktuelle Herausforderungen von Lehrkräften bei der Mediennutzung, etwa durch Formate wie Chatführerschein oder digitale Benimmregeln. Der Praxisdialog diskutiert auch postdigitale Phänomene wie kurze Aufmerksamkeitsspannen und die Strategien sozialer Medien zur Nutzerbindung. TikTok erscheint dabei als Plattform informellen Lernens mit tradierten Unterrichtsformen. Besonders thematisiert wird die Normalisierung antisemitischer Inhalte im popkulturellen Stil über soziale Netzwerke.
Zu Gast ist Christoph Schröder; er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Bildung und Kultur der Universität Jena. Er promoviert zum Verhältnis von Pädagogik und Antisemitismuskritik und analysiert Antisemitismus als erzieherische Ideologie, die sich verstärkt über Social Media verbreitet. Im Projekt „Schulentwicklung: Digital-Demokratisch“ (SchuDiDe) erforscht er gemeinsam mit Schulen, wie ethische Orientierung digitaler Bildung gefördert werden kann.
Shownotes
Antisemistismus bezeichnet feindliche Einstellungen und Handlungen gegenüber Jüdinnen und Juden, die sich auf religiöse, ethnische, soziale oder politische Zuschreibungen stützen und historisch wandelbar, aber durchgängige Stereotype aufweisen. vgl. Ullrich, P., Arnold, S., Danilina, A., Holz, K., Jensen, U., Seidel, I., & Weyand, J. (Hrsg.). (2024). Was ist Antisemitismus? Begriffe und Definitionen von Judenfeindschaft (Bd. 8). Wallstein Verlag.
In Kultur der Digitalität beschreibt Felix Stalder die drei Grundformen der Digitalität: Referentialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität. Referentialität zeigt sich technisch in Hyperlinks, inhaltlich in Zitaten und Remixen. Öffentlichkeit verändert sich, da Publizieren nicht mehr kuratiert ist. Gemeinschaft entsteht über Likes, Klicks und Austausch auf Social Media. Algorithmizität strukturiert Big Data, indem sie Informationen filtert, ordnet und zugänglich macht Stalder, F. (2017). Grundformen der Digitalität. agora42. https://agora42.de/grundformen-der-digitalitaet-felix-stalder/ (Zugriffsdatum: 20. April 2025)
Mit Plattformkapitalismus wird ein wirtschaftliches System bezeichnet, das auf digitalen Plattformen basiert, die eine Vermittlerrolle zwischen Nutzern und Anbietern einnehmen. Interaktionsdaten werden in dieser Beziehung zu einem wichtigen Rohstoff der Verwertung. Haberkorn, T. (2018, Februar 25). Plattform-Kapitalismus: „Wir müssen über Verstaatlichung nachdenken“. ZEIT ONLINE. https://www.zeit.de/kultur/2018-02/plattform-kapitalismus-google-amazon-facebook-verstaatlichung/komplettansicht (Zugriffsdatum: 31. Mai 2025)
Die Kurzfilmformate von Alexander Kluge thematisieren u.a. die sich unter den Vorzeichen von Zappen und Switchen verkürzende Aufmerksamkeitsspanne. Auf dctp-TV spielt er kontrastierend mit der Ästhetik der kurzen Filmform. Winkler, H. (1991). Switching, Zapping: Ein Text zum Thema und ein parallellaufendes Unterhaltungsprogramm (S. 35). Jürgen Häusser; dctp.tv. (o. D.). DCTP – Plattform für unabhängige Autoren und intelligentes Fernsehen. https://www.dctp.tv/ (Zugriffsdatum: 31. Mai 2025)
Die Studie der European Union Agency for Fundamental Rights mit dem Titel „Jewish People’s Experiences and Perceptions of Antisemitism“ thematisiert die Erfahrungen und Wahrnehmungen von Antisemitismus jüdischer Menschen im Raum der Europäischen Union. European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). (2024). Jewish people's experiences and perceptions of antisemitism: Third survey. https://fra.europa.eu/en/publication/2024/experiences-and-perceptions-antisemitism-third-survey (Zugriffsdatum: 31. Mai 2025)
Die Langzeitstudie „Antisemitismus 2.0 und die Netzkultur des Hasses“ von Monika Schwarz-Friesel und Team untersucht kritisch die gestiegene Verbreitung und Normalisierung von Antisemitismus durch die Webkultur. Technische Universität Berlin. (n.d.). Antisemitismus 2.0 – Forschungsprojekt der Professur für Allgemeine Linguistik. https://www.tu.berlin/linguistik/forschung/antisemitismus-20 (Zugriffsdatum: 31. Mai 2025)
In seinem Buch „Terror gegen Juden. Wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt“ untersucht Ronen Steinke die fatale Herstellung von vermeintlicher Normalität, die unzulässig verharmlosend wirkt. Steinke, R. (2020). Terror gegen Juden: Wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt. Berlin Verlag. https://archive.jpr.org.uk/object-4571
In der Veröffentlichung „Was ist Antisemitismus? Begriffe und Definitionen von Judenfeindschaft“, die u.a. von Peter Ullrich, Sina Arnold oder Anna Danilina im Kontext des Zentrums für Antisemitismus herausgegeben wurde, wird der Komplex des Antisemitismus definiert und in aktuelle Diskurse überführt. Ullrich, P., Arnold, S., Danilina, A., Holz, K., Jensen, U., Seidel, I., & Weyand, J. (Hrsg.). (2024). Was ist Antisemitismus? Begriffe und Definitionen von Judenfeindschaft (Bd. 8). Wallstein Verlag.